Bei der Montagsfrage habe ich schon lange nicht mehr mitgemacht. Ich glaube, damals war sie noch bei jemand ganz Anderem. Mittlerweile ist sie bei Lauter & Leise (ihr wisst schon, da, wo damals die tolle Klassiker-Aktion war) und bietet heute eine Frage, auf die ich sehr gern antworten möchte. (Passierte auch schon in der Vergangenheit, aber da hab ich die spannenden Fragen leider immer erst mehrere Tage später entdeckt.)
Kann ein Autor über etwas außerhalb der eigenen Erfahrung schreiben? (Und muss er es sogar?)
Wenn man nur schreibt, was man kennt, was wäre dann noch übrig?
Ich glaube, der Spruch, dass man schreiben soll, was man selbst kennt, könnte schon so alt sein, wie das Schreiben selbst. Und doch ist er schon damals zumindest partieller Unsinn gewesen.
Überlegt euch mal, was wir dann wissen würden? Hätten die alten Ägypter von ihren Göttern schreiben können? Nun wäre zu diskutieren, ob Glaube Erfahrung gleichkommt. Aber wenn man es ganz genau nimmt, hätten sie ihre Mythologie nicht niederschreiben dürfen, weil sie (vermutlich) nicht dabei waren, als Ra dies und Horus das machte.
Ähnliches gilt für die Griechen, die Römer, die Bibel. (Auch wenn ich Letztere persönlich nicht als Verlust werten würde.)
Und denkt an die großen Werke unserer Geschichte. Hat Shakespeare Macbeth getroffen? Hexen? Geister? Elfenkönige? Gut, schön wäre es, aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering. Und Lessing war nicht bei den Kreuzzügen dabei, selbst der Templerorden ist schon lange vor seinem ‚Nathan der Weise‘ ausgelöscht worden. Gut, bei Karl May wäre es vielleicht dann doch besser gewesen, hätte er vorher die Kultur der amerikanischen Natives kennen gelernt, oder hätte sogar sie schreiben lassen. Zumindest ist unser Bild von ihrer Kultur, unter anderem seinetwegen, von so einigen Fehlern gespickt.
Gleichzeitig kann man ihm aber wohl positiv anrechnen, dass so das Interesse für die Kultur hier angefacht wurde und vielleicht die Bühne für Own Voice bereitete (dem die Verlage vielleicht endlich mal nachkommen sollten)?
Own Voice
Own Voice ist, wenn ein Betroffener einer Marginalisierung, Krankheit, etc. selbst über das schreibt, wovon er eben betroffen ist. Ein Autist schreibt also zum Beispiel seine Biografie, oder aber auch einen Roman, in dem ein Autist die Haupt- oder eine tragende Nebenfigur ist.
Der Sinn dahinter ist, einerseits marginalisierten Stimmen ein Forum zu geben, ihnen Gehör zu verschaffen, aber auch, Dinge aus erster Hand zu erfahren, da Autoren, die nur darüber schreiben, ohne selbst betroffen zu sein, eher Fehler einbauen und Stigmatas oder Vorurteile reproduzieren könnten.
Nur noch Own Voice?
Own Voice ist also definitiv nichts Schlechtes, im Gegenteil. Verlage sollten es fördern, mehr darauf setzen.
Aber die Debatte um Own Voice hat teilweise auch Auswüchse gehabt, die ich selbst nicht positiv sehe. So gab es pauschale Aussagen, wie, dass wirklich nur noch Own Voice geschrieben werden sollte. Dass Autoren, die nicht behindert, People of Colour, Überlebende von sexuellen Übergriffen, etc. sind, auch nicht mehr darüber schreiben sollten.
Und das finde ich aus zwei Gründen falsch:
- Es setzt Betroffene unter Druck. Wenn sie wollen, dass ihre Thematiken vorkommen, müssen sie also selbst schreiben. Eigentlich sogar, ob sie wollen, oder nicht. Denn ansonsten sind in dem Fall ja SIE Schuld, wenn keiner Missverständnisse geraderückt. Wenn sie in der Literatur nicht stattfinden. Sie werden so also genötigt, nicht nur überhaupt zu schreiben, sondern immer ihre eigene Behinderung, ihre Rassismuserfahrungen, ihre Traumata in den Mittelpunkt zu stellen. Sie werden darauf reduziert. Und müssen sich auch noch outen, was schlimmstenfalls dazu führen kann, dass genau das, wogegen sie mit ihren Büchern kämpfen wollen, wieder über sie hereinbricht.
Und ganz persönlich, als Behinderte: Ich hab es SO satt, nur auf meine Behinderung reduziert zu werden. Es ist schlimm genug, dass mein Körper bestimmt, wann ich wie weit aus dem Haus gehen kann, was ich esse, wann ich Luft kriege, und, dass ich keine Arbeit finde. Ich will nicht auch noch gezwungen sein, meiner Behinderung in meinen Büchern auch noch Macht über mich einzuräumen. Ja, ich möchte selbst von Leuten mit meinen Behinderungen LESEN. Und vielleicht werde ich auch eines Tages darüber schreiben. Aber ich will mein Schreiben nicht darauf reduzieren. Wenn es einst in einer Geschichte passen wird, werden manche meiner Besonderheiten drin vorkommen. Vielleicht mal alle? Aber dieser Tag ist nicht heute. Heute schreibe ich lieber über die Dinge, die mir Freude bereiten.
- Es schränkt gleichzeitig aber auch Autoren in ihren Geschichten ein und verhindert das, was wir doch eigentlich auch fordern: Normalität in Romanen abzubilden. Verschiedene Ethnien, Sexualitäten, körperliche Eigenschaften völlig normal in Geschichten vorzufinden.
Denn um diese Charaktere lebensecht zu gestalten, muss man auch auf das eingehen, was sie ausmacht. Das sind zunächst mal ihre inneren Eigenschaften, klar. Aber, um in dem Beispiel zu bleiben, mit dem ich mich auskenne: Ein Mensch, der mit Behinderungen aufwächst, eignet sich bestimmte Verhaltensmuster an, die ein Mensch ohne Behinderungen und sonstige Erfahrungen mit gruppenbezogenem Hass eben nicht aufweist. Er muss zum Beispiel, je nach Behinderung, vorher recherchieren, wenn er irgendwo hin will. Ob es da Toiletten gibt, die er nutzen kann. Nötige bauliche Besonderheiten. Vielleicht versucht versucht dieser Mensch, nicht aufzufallen, weil er die mitleidigen oder manchmal angeekelten Blicke nicht mehr ertragen kann. Vielleicht wuchs über die Zeit aber auch einfach ein dickes Fell, um all das auszuhalten, dass sich jetzt aber auch in anderen Situationen in einer bestimmten Art auswirkt?
Und wenn wir Autoren sagen, dass sie über diese Erfahrungen nicht schreiben dürfen, wenn sie sie selbst nicht gemacht haben, sie nicht mal ansatzweise thematisieren dürfen, dann sind wir mit Schuld, wenn die Charaktere, die eigentlich zu mehr Diversität führen sollen, sich anfühlen, als würden sie nur Quoten erfüllen sollen. Als wären sie nur dazu da, um einmal zu sagen ‚Hi, ich bin behindert‘, und dann keine Rolle mehr zu spielen. Oder, als wären sie schlecht recherchiert, nicht lebensecht.
Die Grenzen von Own Voice
Aber noch ein Problem gibt es mit Own Voice, wie hier schon beschreiben. Wenn die Autoren dabei von altbekannten Schemata abweichen, weil die für sie nicht sinnig sind, weil sie selbst es als Leser anders bräuchten und deshalb Own Voice nicht etwa in den Charakteren, sondern den Strukturen eines Romans ‚ausleben‘, haben sie keine Chance. Welcher Nichtbetroffene quält sich schon durch einen Text, der für ihn zu informationslastig und zu passiv geschrieben ist, nur, weil das das ist, was der Betroffene vielleicht braucht?
Und auch, wenn das nicht der Fall ist, sind Own Voice, wenn sie wirklich ins Erleben eintauchen, Erfahrungen mit Hass, Leid, Schmerzen spürbar machen, harter Tobak, den viele nicht lesen wollen. Weil sie nur Unterhaltung suchen. (Und da nehm ich mich leider gar nicht aus. Selbst so tolle Bücher wie ‚The Hate U Give‘ sind sehr schwer zu lesen und benötigen besondere Konzentration und eine dazu passende Stimmung.)
Sprich: Wir alle fordern zwar immer, dass man Betroffene zu Wort kommen lässt, scheuen dann aber doch davor zurück, wirklich in deren Lebenswelt einzutauchen.
Was also dann?
Ich denke, die goldene Mitte ist hier wieder nötig. Autoren müssen gut recherchieren. Wenn sie über sensible Themen schreiben, sollten sie Sensitivity Reader bemühen, oder vorher mit Betroffenen reden, wie man was gut darstellen kann. Nicht nur, um politisch korrekt zu schreiben, was bei vielen, oft eher älteren, männlichen Autoren ja eher verspottet wird (ja, ich sehe Sie an, Herr Hohlbein, der Sie meinten, sich das N-Wort nicht verbieten zu lassen), sondern vor allem, um bessere Charaktere, bessere Geschichten zu schreiben.
Und diese Autoren sollten, wenn möglich, auch an Own Voice-Autoren weiterleiten. Sagen ‚Wer mehr von der Lebenswelt wissen will, kann hier eine wundervolle Biografie finden‘.
Aber wenn wir Menschen nicht mehr über das schreiben dürften, was wir nicht selbst erlebt haben, wäre unsere Literaturwelt deutlich ärmer. Mythologie – und damit heute auch Fantasy und Science Fiction – dürften gar nicht existieren. Krimis dürfte nur schreiben, wer Polizist ist, oder Mörder. Menschen, die aus körperlichen Gründen nicht aus dem Haus können, könnten vielleicht nur darüber schreiben, was sie im Internet erleben, dürften sich aber nicht in Abenteuer träumen.
Eigentlich blieben fast nur Biografien. Und Genres, die ich gerne lese, gäbe es gar nicht mehr. Also nein. Wir sollten schlechte Recherche und plakative Darstellung von Marginalisierten anprangern. Aber es gibt genügend Grunde, warum Autoren über das schreiben sollten, was sie nicht selbst erlebt haben, und genügend Beweise, dass sie das auch können – wenn sie sich Mühe geben.
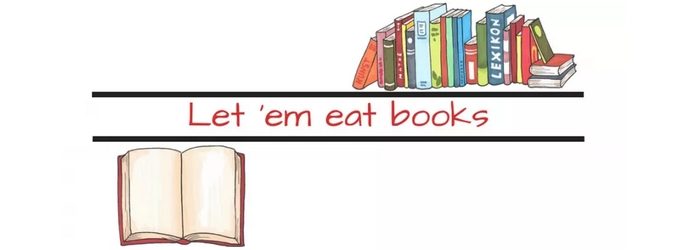
Hey,
Ich freue mich grade zu sehen, dass du an der Montagsfrage teilnimmst und noch mal so intensiv auf Own Voice eingehst, nachdem ich daran bestenfalls an der Oberfläche gekratzt habe.
Viele Grüße
Ariane
Hallöchen noch mal,
wirklich ein Interessanter Beitrag, der einige wichtige Aspekte anspricht.
Mir geht es ähnlich wie dir.
Ich finde #ownvoices gut, aber man sollte marginalisierte Menschen nicht auf ihre Marginalisierung einschränken. Die Möglichkeiten, die du da aufzählst um es gut zu machen sind gut.
Ich sehe noch einen anderen Gefahrenpunkt: Es ist ja nicht jede Marginalisierung sichtbar und dann könnten Leute pranktisch gezwungen werden etwas öffentlich zu machen. Ich bin zum Beispiel bi aber vielen Leuten in meinem Privatleben gegenüber geoutet, aber schreibe über bisexuelle Charaktere.
Oder bei Traumaerfahrungen will das auch nicht jeder öffentlich machen. Ich glaube da gab es vor ein paar Monaten in den USA einen Fall, wo jemand praktisch gezwungen wurde diese öffentlich zu machen, aber ich kenne die Details nicht
LG
Elisa
Huhu Elisa,
Recht hast du. Das finde ich auch ärgerlich. Auch hier in Deutschland kam dazu mal in einer Diskussion der Kommentar „Wenn du dich nicht outen willst, dann schreib halt nicht darüber“. Ich hätte die Wände hochgehen können. Ich mein, mit den meisten meiner Behinderungen und Krankheiten geh ich mittlerweile recht offen um. Aber ich kann mir das auch nur erlauben, weil ich jede Hoffnung, je einen Job zu kriegen, eigentlich aufgegeben habe. Andere Leute gefährden damit ihre Positionen, wenn sie offen über ihre Behinderungen oder Sexualitäten reden, anstatt nur darüber zu schreiben und es nicht als OwnVoice zu kennzeichnen. Das vergessen viele gern.
Also ja, danke, dass du den Punkt aufbringst, den hab ich komplett vergessen gehabt. Dabei regt er mich doch so auf.
LG
Taaya